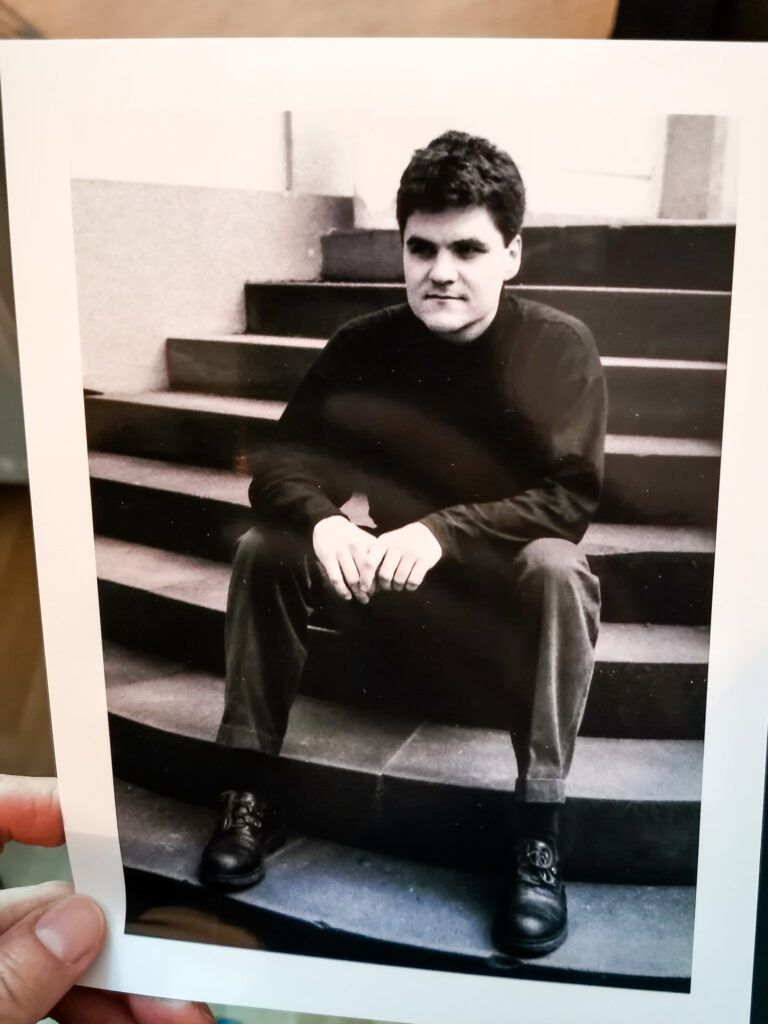Zeitzeug:innen - zu den Einzelseiten
Markus Rindt


Foto: Manja Herrmann
Markus Rindt wurde 1967 in Magdeburg in eine musikalische Familie hineingeboren, die maßgeblichen Einfluss auf seine persönliche Laufbahn hatte. Schon früh als Kind gefördert, besuchte er in Dresden die Spezialschule für Musik und wurde später zum Musikstudium zugelassen. Bereits als Kind hegte er Fluchtgedanken und erklärte sich die Flucht aus der DDR zu einem langfristigen Ziel. Durch Freund:innen und Kommiliton:innen verstärkte sich seine oppositionelle Haltung. Für eine seiner kritischen Aktionen wurde er beinahe exmatrikuliert. Im Jahr 1989 beschloss der damals 20-Jährige gemeinsam mit seiner damaligen Freundin, die Flucht über die Donau nach Serbien oder den Grenzfluss Theiß zwischen der Slowakei und Ungarn zu versuchen. Seinem Vater versprach er jedoch, zuerst die Ausreise über die bundesdeutsche Botschaft in Prag zu versuchen. Nachdem sie zwei Tage aufgrund der überfüllten Botschaft auf dem Vorplatz rasteten, durften sie ausreisen und siedelten sich in Köln bei den Eltern seiner Freundin an. Dort konnte er weiter studieren und nahm internationale Auftritte an, die ihn in die ganze Welt führten.
1993 einem Auftrag nach Dresden folgend, kehrte er in den Osten zurück und siedelte sich langfristig in Brandenburg an der Havel an. Dort wohnt er bis heute mit seiner Familie und arbeitet in Dresden als Intendant der Dresdner Sinfoniker.
Aus welchen Gründen hast du damals die DDR verlassen, was war deine persönliche Motivation?
Ich hatte in Dresden Musik studiert, und für mich war [es] immer ein Ziel [gewesen], in ein Orchester zu kommen, mit dem ich in den Westen reisen kann. Also möglichst in ein Spitzenorchester wie die Staatskapelle Dresden, die Dresdner Philharmonie oder die Berliner Staatskapelle. Man hörte ja oft: Sobald du in Rente bist, kannst du die Welt bereisen. Und wenn man das als junger Mensch hört, ist es eigentlich unerträglich.
Als ich 20 war, hatte ich eine Freundin, deren Eltern bei einer Besuchsreise im Westen geblieben sind. Zu besonderen Anlässen erteilte die DDR manchmal tatsächlich Genehmigungen für Besuchsreisen. Nach ein paar Tagen bekamen wir einen Anruf, dass sie nicht wiederkommen. Und wir hatten plötzlich in Radebeul bei Dresden ein Auto, eine ganz fantastische, schöne und voll eingerichtete Wohnung und ein Landhaus im Erzgebirge. Ich hatte gegen Ende meines Studiums auch eine Solo-Horn Stelle in den Landesbühnen Sachsen in Radebeul und es gab aus materieller Sicht eigentlich keinen Grund, auszureisen.
Es war aber so, dass meine Freundin gerne Kunst studieren wollte. Sie wurde dann von dem Rektor der Hochschule einbestellt, der ihr klar gemacht hat, wenn sie nicht für die Stasi tätig werden würde, dann könnte sie ihr Studium vergessen. Zudem kam noch, dass die Eltern, die damals geflohen sind, zum Beispiel die Semperoper aufgebaut [und] im musealen Bereich gearbeitet haben, die waren wirklich Kapazitäten in ihrem Bereich. Und die Stasi hat das nicht so einfach hingenommen. Sie hat dann meine Freundin und deren Schwester zum täglichen Verhör einbestellt. Es wurde unterstellt, dass das keine normale Flucht gewesen war. Das ging dann einige Zeit und das hat meiner Freundin auch gereicht, [sie] hat damals einen Ausreiseantrag gestellt. Dann war [auch] für mich die Sache klar: Ich bin nicht in einem dieser Spitzenorchester gelandet und ich hatte auch den Eindruck, dass ich das demnächst nicht schaffen würde, weil ich beim Probespielen [um freie Orchesterstellen] immer sehr aufgeregt war. Und [dann] dachte ich mir: Dann reisen wir jetzt aus.
Du hast erzählt, dass du schon von Kindheit an Fluchtgedanken hattest. Hat man das als Kind verstanden, dass man nur eingeschränkte Möglichkeiten hat?
Ich habe [bereits] als Kind verstanden, dass das wohl so ist. Meine Großeltern wohnten in Barneberg in der Nähe von Helmstedt. Barneberg befand sich in der sogenannten Sperrzone, in die man nur mit einem Passierschein hinein konnte. Man musste den beantragen, wir konnten meine Großeltern nicht einfach so besuchen, denn die wohnten an der richtigen Grenzanlage. Mein Opa ging dort oft mit mir spazieren und sagte: Schau mal die Häuser dahinten, die sind bereits im Westen! Und dann hat er mir von seinen Reisen nach Köln oder Bayern erzählt. Er als Rentner konnte ja reisen. Menschen haben ganz oft von ihren Erlebnissen aus dem Westen berichtet und es [wie] ein Schlaraffenland gezeichnet. Die Luft [sei] reiner, das Gras grüner und alles besser. [Es] ging nicht nur um Äußerlichkeiten, sondern auch [darum], wie man sich verwirklichen kann. [Die Möglichkeit] die Welt zu bereisen, lesen zu können, was man will oder Filme gucken zu können, die man möchte. Überhaupt alle Informationen zu bekommen.
Und wenn man das als Kind auch von anderen, Erwachsenen, hört, dann macht das etwas mit einem. Meine Tante hat mir zum Beispiel einen Globus geschenkt, als ich in der ersten Klasse war. Stundenlang habe ich den studiert, gedreht und mir überlegt, wo ich [überall] hinreisen [würde, wenn ich] könnte. Ich habe mich sehr für Geographie interessiert und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass dieses kleine Land, [die DDR] alles sein sollte. Natürlich wollte ich die Welt kennenlernen.
Du hattest bereits erwähnt, dass du Freunde hattest, die kritisch bzw. oppositionell eingestellt waren. Kanntest du denn auch Personen, die zum Beispiel im Neuen Forum tätig waren?
Nein, nicht persönlich. Aber ich muss dazu sagen, dass die Musikstudenten [in der DDR] relativ oppositionell [eingestellt] waren. Viele dieser Musikstudenten hatten Eltern, die in der Kirche tätig waren. In diesem musikalischen Umfeld [herrschte] ein kritischer Geist gegenüber diesem Staat. Das führte dazu, dass Studenten anderer Hochschulen gesagt wurde, sie sollen vorsichtig sein vor diesen Musikstudenten, die seien Staatsgegner. Und es war auch so, dass wir im Musikstudium diesen 1. Mai-Umzug [von 1988] vollkommen platzen lassen haben als Protestaktion. Oder die Überlegung bei der Kommunalwahl [1989], sie zu stören, indem man alle Kandidaten durchstreicht.
Ich würde sagen, dass hängt auch mit dem kirchlichen Hintergrund zusammen, den viele Musiker hatten. Und deswegen würde ich auch behaupten, dass die Montagsdemos, die in Leipzig im geschützten Raum Kirche entstanden sind, anders gar nicht möglich gewesen wären. Dass sich Menschen, die kritisch sind und etwas bewegen wollten, durch diese gemeinsamen Gottesdienste, die dieses Podium geboten haben, finden konnten. Das wäre in einem anderen Raum nicht gegangen.
Kommen wir zu der Flucht, du hattest bereits erwähnt, dass dein Vater euch in Mělník abgesetzt hatte. Gab es Kontakte zur tschechoslowakischen Bevölkerung und in Prag Berührungspunkte mit anderen Geflüchteten?
Als wir [in Prag] ankamen und vollkommen ratlos vor einem Stadtplan der Stadt standen, wussten wir beide nicht, wo wir hin sollten. Und da standen auch viele andere [Ostdeutsche] neben uns. Keiner hat sich getraut, den anderen anzusprechen. Es gab dieses Gefühl, das könnte eine Provokation [der Stasi] sein, die könnten hier stehen und kassieren uns dann ein. Als uns bayerische Touristen den Weg zeigten und wir dann alle über die Karlsbrücke liefen, war klar, alle haben das gleiche Ziel. Und wir standen dann vor der [überfüllten] Botschaft und kamen nicht mehr rein. Es war klar: Hier kann man jetzt nicht bleiben, das bringt nichts, wir stehen ja außerhalb des Geländes. Aber wir warten hier jetzt mal. Und da haben sich natürlich viele Gespräche ergeben. Es gab auch Momente des Misstrauens dort. Ich kann mich zum Beispiel sehr gut erinnern, dass ein Fotograf vom Dach fotografiert hatte, sicherlich Presse. Und [als] er herunterkam mit seiner Kamera, haben sie den gegriffen, die Kamera genommen, aufgemacht und den Film herausgerissen. Also eine panische Angst davor, dass sie darauf [zu sehen] sein würden, weil er vom Dach fotografiert hat.
Irgendwann wurde gesagt, die Tschechen würden auch die tausenden Menschen [auf dem Botschaftsvorplatz] mit zu [den Geflüchteten] rechnen. Wir konnten uns dann auch frei bewegen. Es gab diese Radios, die überall standen und da wurde immer Deutschlandfunk gehört. Und dann kam irgendwann diese Nachricht, dass alle, die sich in und außerhalb der Botschaft befinden, ausreisen könnten. Der Begeisterungssturm ging los und alle fielen sich um den Hals. Die tschechische Polizei hatte nicht nur diesen Platz abgesperrt, sondern ein wesentlich größeres Gebiet. Ich konnte sogar noch in ein Restaurant gehen mit meiner Freundin. Es gab ein Geschäft, wo man rein konnte, da habe ich noch eine Flasche Bohemian Sekt gekauft für den Fall, dass wir es schaffen. Und es gab natürlich auch die Bedürfnisse, irgendwo auf das Klo gehen zu müssen. Einige tschechische Familien hatten dann ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt und auch teilweise etwas zu essen [und] zu trinken gebracht. Wir wurden ja nicht mehr von der Botschaft direkt versorgt, sondern von der [örtlichen] Bevölkerung, die da wohnte. Und das fand ich super nett. Man hatte das Gefühl, dass sie auf jeden Fall mit uns sympathisierten.
Hattest du Angst, vor der Botschaft abgefangen zu werden und hattest du dir vorab Gedanken darüber gemacht, was passieren mag, wenn du in so eine Situation gerätst?
Wir sind gar nicht so einfach dahin gekommen. Als wir von der Karlsbrücke heruntergingen, standen da hunderte Menschen und auf der anderen Seite ein Spalier von Soldaten. Es war die Straße, die zur deutschen Botschaft hochführt. Und dieses Spalier von Soldaten mit Maschinengewehren war undurchdringlich. Es waren extrem viele hinter uns, auch entschlossen, [in die Botschaft] zu kommen. Aber da durchzugehen war eigentlich unmöglich [gewesen]. Dann ist ein Vater mit seinen beiden Kindern an der Hand auf die Soldaten zugegangen und die Mutter hinterher, und die Soldaten haben ihn durchgelassen. Das war das Signal für alle anderen. Aber bis dahin war mir nicht klar, ob wir da durchkommen.
Andererseits hatten wir diesen back-up Plan nach dem Motto: Wenn wir es hier nicht schaffen, das war ja das Versprechen, was ich meinem Vater gegeben hatte, dann fahren wir auf jeden Fall in die Slowakei und werden über den Fluss schwimmen. Ich hatte das seit Kindheit an geträumt dieses Abenteuer. Nicht nur überlegt, wie man es macht, sondern abends [wach] gelegen und darüber viel nachgedacht als Jugendlicher. Also [einen] Tunnel [zu] graben oder ein Floß [zu] bauen, [um] über die Ostsee zu fahren. Alles, was man sich vorstellen kann, habe ich mir überlegt. Und es war von Kindheit an eigentlich klar, dieses Abenteuer mache ich irgendwann mal. Man muss allerdings sagen, dass es natürlich tausendmal besser [war], dass uns nichts passiert ist, dass es so gut und reibungslos geklappt hat. Es hätte wirklich viel passieren können, wie zum Beispiel bei meinem Schulkameraden, der sich eine schwere Lungenentzündung eingeholt hat beim Überqueren der Donau.